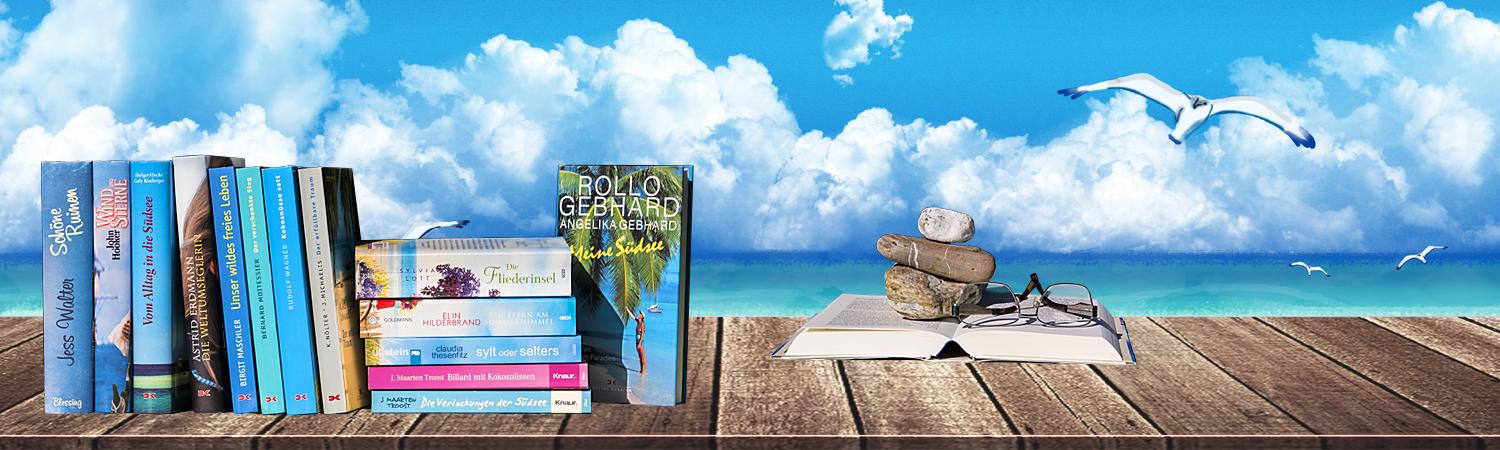Abenteuer in der Südsee

Ich selbst besitze eine ältere Ausgabe von Hoffmann und Campe aus dem Jahr 1967, als Lizenzausgabe der Dieterich’schen Verlagsbuchhandlung Leipzig (also DDR). Die Übersetzung stammt von Ilse Hecht, die ebenso ein Nachwort für diese Ausgabe verfasste. Es sind ferner zwölf schwarz/weiß Illustrationen enthalten, laut Impressum aus dem Bildarchiv der Staatsbibliothek Berlin.
Wer den Klappentext liest, kann sich bereits gut vorstellen, was einen erwartet. Für mich ist es etwas schwierig zu beschreiben: die von Melville (im Buch: Tom) erlebten und geschilderten Abenteuer sind erstklassig (auch wenn es ihm dabei nicht immer erstklassig erging). Die Beschreibungen der Landschaft, der Natur, der fremden Menschen, ihren Tätigkeiten und Angewohnheiten legte Melville sehr bildhaft an.
Aber es ist auch irgendwie in der Art einer nüchtern verfassten Beschreibung geschrieben. Eine Beschreibung, wie man sie den Daheimgebliebenen gibt, damit sie sich die Ferne ebenso vorstellen können. Ja, ich konnte mir die Exotik vorstellen. Auch die teilweise damit verbundene große Mühsal. Doch in der Zeit, in der die Dinge mit Worten beschrieben werden, hatte ich oft das Gefühl, der Fortgang der Romanhandlung gerät dadurch ein wenig ins Stocken.
Es ist gut möglich, dass es an meiner (älteren) Überetzung liegt. Es gibt ja auch eine Neuere von Alexander Pechmann («Typee»). Vielleicht ist es dort anders, ich habe es nicht verglichen. Jedoch bevorzuge ich trotz allem ältere Übersetzungen. Denn aktuell kann es auch gut passieren, dass neuere Übersetzungen sich dem modernen Sprachgebrauch besser anpassen (was begrüßenswert ist), jedoch aufgrund der neuerdings so vehement eingeforderten politischen Korrektheit auch mal bestimmte Dinge/Wörter viel unklarer versuchen zu umschreiben, als vom Autor ursprünglich beabsichtigt. Sowas muss ich nicht haben.
Melville beweist dennoch von Zeit zu Zeit großen Witz. Den Verzehr des letzten Hahnes Pedro auf dem Schiff durch den Kapitän möchte ich hier gerne kurz zitieren (es ist einfach zu gut):
Nächsten Sonntag wird der dürre Leichnam auf dem Tisch des Kapitäns aufgebahrt und noch vor dem Abend mit all den üblichen Feierlichkeiten unter der Weste dieses würdigen Mannes bestattet.
Gesellschaftskritik vermag ich in den Schilderungen keine herauszulesen. Die Engländer und Franzosen sind wie sie sind, die Eingeborenen Taipis ebenso. Ein interessantes Detail in der Erzählung ist vielleicht, dass Melville die Sprache der Taipi nur ganz rudimentär zu erlernen vermag. Deswegen ist er auch bei ihren Handlungen und Ritualen oftmals auf Mutmaßungen angewiesen.
Melville zeigt nach meinem Gefühl die gegenseitige Neugier der unterschiedlichen Kulturkreise aufeinander, wie gleich wir im Grunde doch alle sind. Aber auch wie verschieden wir sind. Besonders deutlich wird das an der Beziehung Toms/Melvilles zu seinem ständigem Taipi-Diener Kory-Kory.
Und dieses gegenseitige Interesse macht bei all meiner Kritik (siehe oben) Freude beim Lesen, weckte mein Interesse immer weiter zu lesen und quasi das Polynesien in der Zeit um 1840/50 literarisch zu erleben.