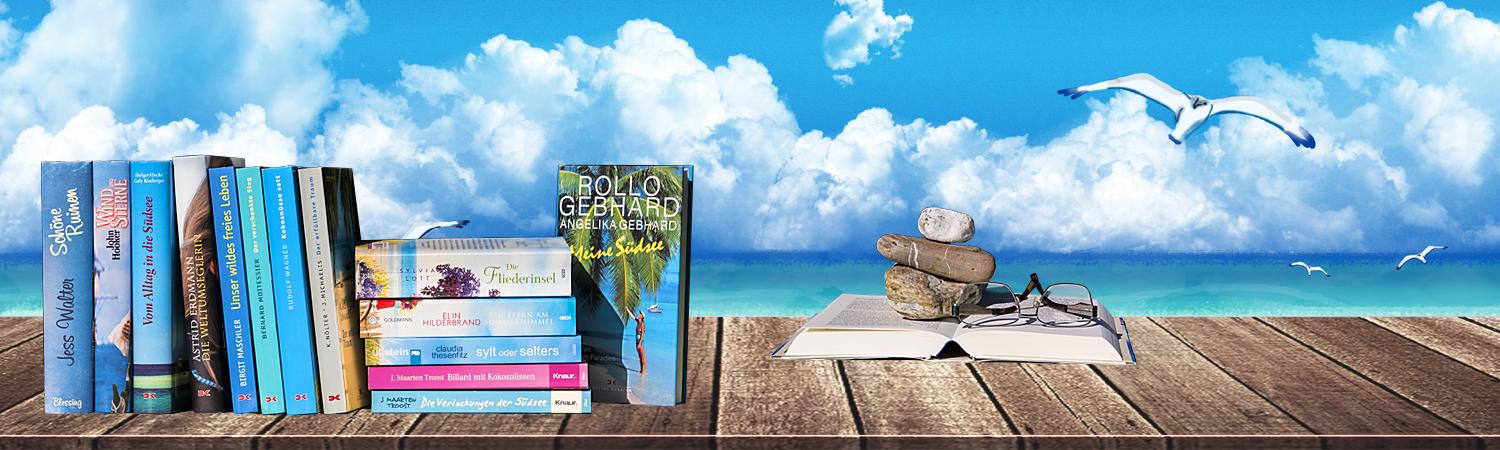Abenteuergeschichte im Golf zwischen Kuba und den Florida Keys

 ) und lege sie direkt im Anschluss ein.
) und lege sie direkt im Anschluss ein.
Genauso geht es mir mit Schriftstellern. Gerade habe ich Hemingways Der alte Mann und das Meer ausgelesen, als das eben erst im Antiquariat bestellte Heft mit Haben und Nichthaben eintrifft und Hemingway in meiner Lese-Hängematte eine Zugabe gibt (das Wort “Lese-Hängematte” gibt es nicht, aber heißt es nicht auch “Lese-Sessel”?).
Tempo und Spannung
Das erste Kapitel ist bereits schon so voller Action, da werden gerade mal so nebenbei drei Männer auf offener Straße abgeknallt inklusive Bauchschuss, man glaubt in einem Mafiafilm zu sein, doch schon am nächsten Morgen geht es raus zum Angeln mit einem zahlenden Urlauber als Angler. Dazu der kurze und knappe Erzählstil Hemingways. Meine Ausgabe des Romans wurde in der DDR aufgelegt hat diese doppelten Textspalten pro Seite, also wie eben die Groschen-Wildwest-Romane von zum Beispiel G.F. Unger, so dass ich stellenweise beinahe glaube, in einem dieser “Schmutz- und Schundromane” zu sein (sorry, das war Schrieb und Sprech der ehemaligen DDR über diese “westliche” Literatur – und ganz und gar nicht meine eigene Meinung!). Ich dagegen lese ja ein Exemplar der Romanzeitung, eine Zeitschriftenreihe der DDR aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. In dieser Reihe bekamen also nicht nur sozialistisch ausgerichtete Schreiber ihre Veröffentlichung, sondern auch international anerkannte Erzähler wie Ernest Hemingway. Dennoch fragte ich mich beim Lesen auf manch einer der ersten Seiten, was der Unterschied zu den teils etwas verrufenen Groschenromanen ist.
Persönliche Nähe
Weder habe ich Hemingway persönlich gekannt (selbstredend ) noch einen seiner Romanhelden, wenn es sie denn jemals tatsächlich gegeben hätte.
Eine gewisse persönliche Nähe zwischen Hemingways Geschichte und mir kommt jedoch durch unsere Besuche auf den Florida Keys und insbesondere von Key West auf.
Denn auch geographische “Gemeinsamkeiten” lassen einen Roman noch interessanter erscheinen, ich will vergleichen, wiedererkennen. Das geht anderen Leuten doch mitunter ebenso, nicht wahr?
) noch einen seiner Romanhelden, wenn es sie denn jemals tatsächlich gegeben hätte.
Eine gewisse persönliche Nähe zwischen Hemingways Geschichte und mir kommt jedoch durch unsere Besuche auf den Florida Keys und insbesondere von Key West auf.
Denn auch geographische “Gemeinsamkeiten” lassen einen Roman noch interessanter erscheinen, ich will vergleichen, wiedererkennen. Das geht anderen Leuten doch mitunter ebenso, nicht wahr?
Wechsel der Erzählsituationen
Am Anfang ist das Buch aus der Sichtweise eines Ich-Erzählers, der mehrmals sogar den Leser direkt anspricht:Im zweiten Oberkapitel Herbst (das erste Oberkapitel hieß Frühling) ändert sich plötzlich der Blickwinkel für den Leser: ein Gespräch auf einem Boot geht zwischen einem “Nigger” und einer nicht näher beschriebenen weiteren Person. Bis dann ein Absatz so beginnt:
Ich-Erzähler: Um seine äußerlich triviale Erzählung die gebotene Tiefe zu verleihen scheut sich Hemingway nicht, ein ganzes Kapitel, wenn auch kein langes, nur die Gedanken Harry Morgans wiederzugeben. Diese “Gedankenoffenlegung” bemüht Hemingway immer wieder mal, doch so ausführlich in einem längeren Gedankenmonolog ist das schon ungewöhnlich (ein ähnlich langer Gedankengang, diesmal von einer Frau, kommt gegen Ende des Romans noch einmal vor).
Letztlich schafft es Hemingway dadurch letztlich aber mühelos, den profanen, unrechten und teils gewalttätigen Entscheidungen und Handlungen Morgans auf diese Weise einen Rahmen der Nachvollziehbarkeit zu geben.
Moral
Mit der brutalen Schießerei gleich zu Beginn des Romans (siehe oben) charakterisiert Hemingway dem Leser unmissverständlich das Umfeld, in dem sich unser Romanheld Harry Morgan bewegt.Die Situation für viele Fischer und einfache Menschen zwischen den Keys und Kuba zu dieser Zeit (1930er Jahre) waren völlig anders, als wir sie in unserem Lebenslauf je erlebt haben. Diese Charaktere kämpfen ums Überleben, ja sie werden oft in moralisch graue Handlungen gedrängt, nur um zu überleben. Doch warum zum Teufel tötet Harry den Chinesen Mr. Sing nach der Übergabe der zwölf zu schmuggelnden Chinesen? Diese Aktion kam mir etwas überraschend und im ersten Moment gar nicht nachvollziehbar. Andererseits verdeutlicht dieser brutale Akt die Verzweiflung von Harrys Situation und fordert von mir ein, mich mit seinen komplizierten moralischen Entscheidungen auseinanderzusetzen.
Es geht also um den Druck in den Situationen von Harry Morgan, in der die Möglichkeiten seiner Entscheidungsmöglichkeiten sehr begrenzt sind. In der Folge zwingt ihn die augenblickliche Sachlage in moralische Dilemmas, die wir in unserer “behüteten Welt” im Mitteleuropa des ausgehenden zwanzigsten bzw. beginnenden einundzwanzigsten Jahrhunderts nur schwer nachvollziehen können.
Damit stellen sich diese Charaktere Hemingways – im Gegensatz zu dem von Jack London beschriebenen Seewolf – als in Zwangssituationen eingeschränkt entscheidungsfähig dar, für die unmoralisches Handeln eher recht und billig scheint, da sie vermeindlich tun müssten, was sie tun. Der Seewolf hingegen, der ein Exemplar von Nietzsches Übermensch darstellen soll, handelt unmoralisch, weil ihm bestehende Moralvorstellungen nichts bedeuten, er sich also von vornherein über sie und damit über die gesamte menschliche Gemeinschaft stellt.
Wie gesagt, ich befinde mich nicht in einer “moralischen Zwangslage”, habe mich nie in einer solchen befunden und bin erst recht kein sogenannter Übermensch. Doch ich will und kann weder den einen noch den anderen Moralbruch rechtfertigen.
Die “Zwänge”
Harry sinniert:Morgan selbst sinniert an einer Stelle im Buch, dass er ja auch Postbote in Key West werden könnte oder etwas ähnlich schlecht bezahltes, dafür aber ungefährliches. Manch anderer tut dies ja auch. Denn ihm ist ja selbst der Konflikt klar, der zwischen der Bereitschaft für seine Familie zu sorgen, also zwischen seinen Pflichten als Ehemann und Vater und den moralischen Ambivalenzen seiner Arbeit besteht. Denn Morgan findet sich letztlich in einem Kreislauf aus Verbrechen und Überleben gefangen.
Hemingway: jeder Satz, jede beiläufige Bemerkung ist von Bedeutung
Am Ende des Hefts wird Hemingway knapp vorgestellt und über seinen Erzählstil von sprödem, kanppen Prosastil gesprochen, bei dem jeder Satz, jede beiläufige Bemerkung von Bedeutung ist.Mit diesem Wissen im Hinterkopf brauchte ich für das Lesen mancher Passage etwas länger und ich fragte mich an manch einer Textstelle, was nun genau dieser Satz bedeutet bzw. warum steht er überhaupt da:
In diesem Roman fand ich viele solcher Doppelungen, ja gerne sogar werden insbesondere Gedanken von Protagonisten noch wesentlich öfter wiederholt. Also gehe ich einfach mal von Absicht aus, denn wenn ich mir den oben zitierten Satz einfach noch mal “durch den Bauch” gehen lasse, dann kann ich ihn als geschickt gesetzte Verstärkung sehr gut nachfühlen und verstehen.
Fazit
Das Wort Groschenromane nahm ich oben schon mal in den Mund. Nun, das kann ich nach dem vollständigen Lesen des Romans vollständig entkräften. Hemingway beschreibt eben in genau diesen brutalen Szenen die Verschlungenheit der menschlichen Psyche und die Komplexität der Handlungsentscheidungen.Im Grunde zeigt das Buch (auch am Beispiel weiterer Nebencharaktere) das Ziel, das alle im Laufe der Handlung suchen oder zumindest irgendwann mal gesucht haben. Es geht um Nähe und Geborgenheit, um Liebe, um Sicherheit im Leben. Jeder einzelne im Buch stand auf seine Weise für dieses Ziel, wenn auch auf verschiedenen Wegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Frau oder Mann handelt. Frauen tun das für sie Entscheidende und Mögliche zur Erreichung dieses Ziels, Männer üben eben ihren männlichen Part aus, bei dem es i.d.R. ums Geldverdienen und die wirtschaftliche Sicherheit der Familie geht.
Mary, die Frau von Harry Morgan bzw. zu diesem Zeitpunkt bereits seine Witwe, brachte es mit einem kurzen Gedankengang auf den Punkt:
Wenn man sich Zeit nimmt und sich in einen Hemingway “hineinkniet” dann entpuppen sich seine Ausführungen als wahre Schätze, die alles andere als oberflächlich, sondern realistisch und gefühlvoll sind.
Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Hemingway-Buch, das ich lesen werde, wenn auch ich nicht unmittelbar sofort jetzt im Anschluss.
Ich habe es mir jedenfalls inzwischen schon mal aus einem Antiquariat zugelegt: Inseln im Strom
 .
.
Exkurs: Der ehemalige Wohnsitz Ernest Hemingways in Key West
In unserem Film, Entlang der USA Golfküste besuchten wir das ehemalige Haus Hemingways in der Whitehead Street. Unseren Videoclip darüber möchte ich euch hier vorstellen: